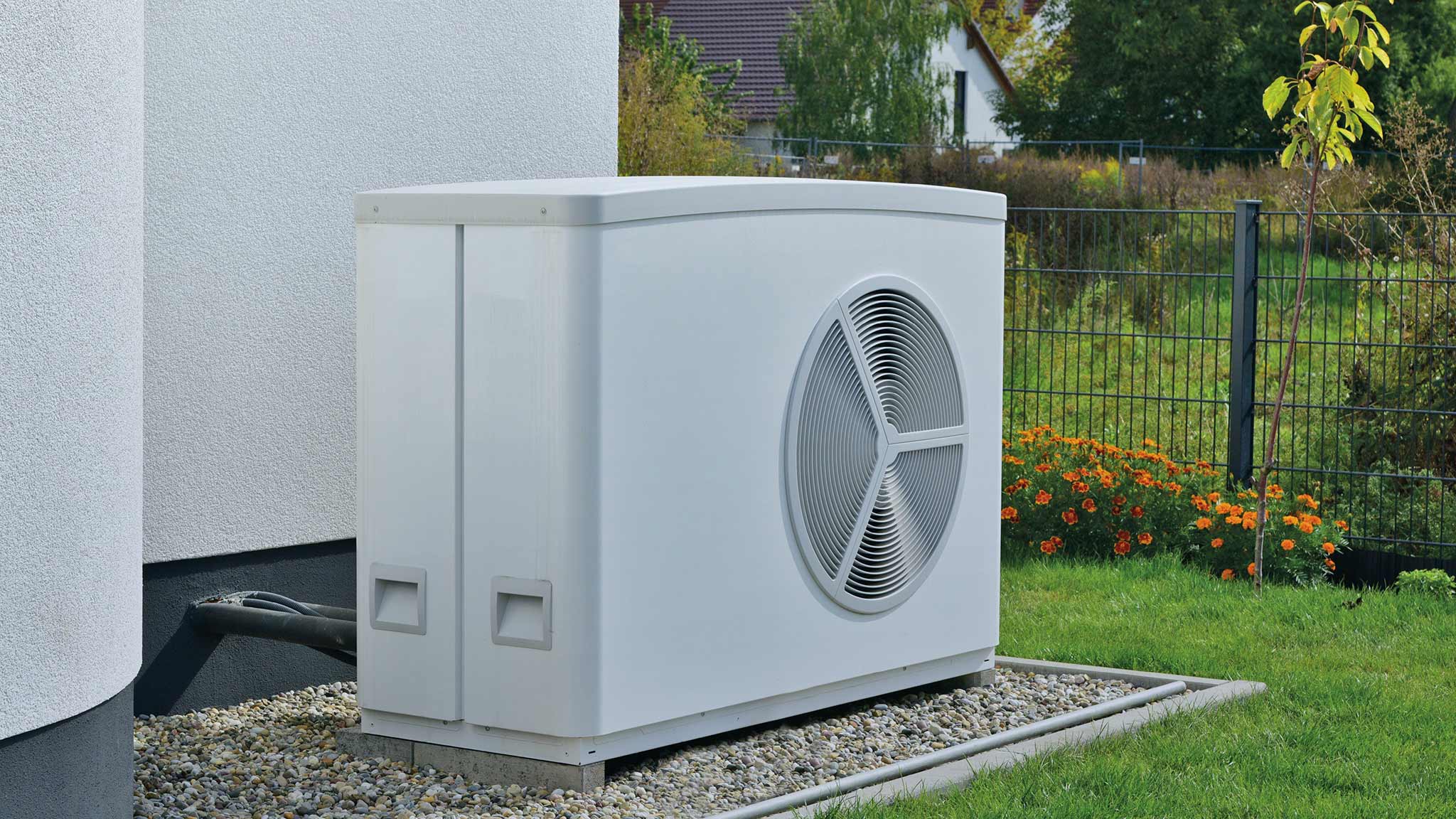Technisch sind Wärmepumpen elektrische Heizungen, die aber den grössten Teil ihrer Heizenergie von einer äusseren Quelle beziehen und diesen äusseren, «Umweltwärme» genannten Energie-Input mit Hilfe eines Kompressors verdichten, der von einem Elektro- oder Gasmotor angetrieben wird. Allerdings gibt es in der Schweiz kaum Gas-Wärmepumpen. Die äussere Wärmequelle kann Aussenluft oder Industrieabluft sein oder auch die Wärme aus der Erde, aus der Kanalisation, aus Seen oder Fliessgewässern.
Wärmepumpen kurz und knackig
- Wärmepumpen funktionieren wie Kühlschränke – nur umgekehrt.
- Wärmepumpen sind elektrische Heizungen, aber viel effizienter als die alten Elektrospeicherheizungen.
- Wärmepumpen nutzen Umgebungswärme, Erdwärme oder Abwärme.
- Wärmepumpen machen aus einer Kilowattstunde (kWh) Strom 3,5 bis 5 kWh Wärme-Nutzenergie.
- Wärmepumpen und richtig dimensionierte Photovoltaikanlagen (PVA) sind eine perfekte Kombination.
- Die Energieberatung von Primeo Energie findet gemeinsam mit Ihnen das passende System.
Im privaten Bereich kommen Luft-Wasser-Wärmepumpen und Sole-Wasser-Wärmepumpen am häufigsten zum Einsatz. Erstere nutzen die Wärme der Aussenluft, Letztere die Wärme in der Tiefe des Erdreichs. Sole-Wasser-Wärmepumpen sind teurer, weil dafür eine oder mehrere Bohrungen von etwa 90 bis 180 Metern Tiefe nötig sind. Dafür benötigen sie deutlich weniger Strom als Luft-Wasser-Wärmepumpen. Es gibt auch Luft-Luft-Wärmepumpen, die ohne Heizkreislauf direkt die Innenluft erwärmen. Sie eignen sich vor allem für Niedrigstenergie-Häuser, die ohnehin kaum mehr Heizenergie brauchen. Solche Anlagen werden deshalb oft direkt mit der Komfortlüftung verbunden.
Wie funktioniert eine Wärmepumpe?
Eine Wärmepumpe funktioniert wie ein Kühlschrank. Denn dieser erzeugt mehr Wärme als Kälte, und auch die Wärmepumpe kann kühlen, wenn sie rückwärtsläuft. Den Kern in beiden Systemen bildet ein Kältemittel, das beim Verdampfen Wärme aufnimmt und beim Kondensieren Wärme abgibt.
Wärmepumpen verwenden ein Kältemittel, das schon bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt verdampft und somit auch bei sehr tiefen Temperaturen noch Wärme aus der Umgebung aufnehmen kann. Um diese Temperatur mechanisch zu erhöhen, komprimiert der Kompressor das nun gasförmige Kältemittel. Das gleiche Prinzip bringt eine Fahrradpumpe zum Erhitzen, wenn man den Luftauslass blockiert. Das heisse Kältemittel gibt seine Wärme an den Heizkreislauf der Heizung ab und kühlt dabei ab. Und dann geht’s wieder von vorne los.

So funktioniert eine Wärmepumpe: Umweltwärme verdampft ein Kältemittel (links), die Wärmepumpe verdichtet das Gas und erhöht so dessen Temperatur (oben). Bei der anschliessenden Kondensation gibt das Mittel die Wärme an den Heizkreislauf des Gebäudes ab (rechts).
Das Kältemittel wirkt wie eine thermische Übersetzung für mehr Leistung, ähnlich wie die Zahnradübersetzung beim Velo. Man spricht dabei vom «Coefficient of Performance» (COP) oder von der Leistungszahl. Pro eingesetzte Kilowattstunde (kWh) Strom erzeugt eine Luft-Wasser-Wärmepumpe so dank der Nutzung zusätzlicher externer Wärmequellen wie Erdwärme, Abluft oder Aussenluft etwa 3,5 kWh nutzbare Wärme. Ihre Leistungszahl beträgt somit 3,5. Die Leistungszahl sinkt allerdings bei tiefen Temperaturen und beträgt bei Aussentemperaturen unter etwa –5 °C nur noch 1. Der Stromverbrauch entspricht dann jenem einer altmodischen elektrischen Widerstandsheizung. Sole-Wasser-Wärmepumpen haben eine Leistungszahl von 5 und teilweise höher. Die Erdsonde reicht in Bodentiefen hinein, in denen die Temperatur ganzjährig 13 °C bis 15 °C beträgt. Sole-Wasser-Wärmepumpen sind damit effizienter als Luft-Wasser-Wärmepumpen und vor allem ganzjährig immer gleich effizient, egal, wie kalt es draussen ist.
Sind Wärmepumpen eine erprobte Technologie?
Wärmepumpen entstanden parallel zur Kältetechnologie, weil die Prozesse dieselben sind. Die erste kommerzielle Wärmepumpe der Schweiz wurde schon 1877 in der Saline in Bex im Kanton Waadt installiert. Zwischen 1937 und 1945 bauten die damals in der Energietechnik führenden Schweizer Unternehmen Sulzer, Escher Wyss und Brown, Boveri & Cie. rund 35 Wärmepumpen als Heizungen für grössere Gebäude. Als Wärmequellen dienten hauptsächlich See-, Fluss- und Grundwasser sowie Abwärme. International bekannt ist die 1937 von Escher Wyss im Rathaus von Zürich installierte Anlage. Sie nutzte die Wärme der Limmat und sollte damals Platz und vor allem Kohle sparen. Erst nach 63 Jahren ersetzte eine modernere Anlage im Jahr 2001 diese Pionier-Wärmepumpe. Die historische Anlage blieb aber erhalten und ist täglich während etwa einer Stunde in Betrieb.
Wie teuer sind Wärmepumpen?
Für eine Ersatzanlage einer Öl- oder Gasheizung in einem Einfamilien- oder kleinen Mehrfamilienhaus müssen Sie mit Installationskosten im Bereich von rund 45 000 bis 50 000 Franken rechnen. Anlagen mit Erdsonden und den dazugehörenden Bohrungen kosten etwa 70 000 Franken oder mehr, benötigen im Betrieb aber rund 30 Prozent weniger Strom. Daniel Arm, Energieberater bei Primeo Energie, sagt dazu: «Viele Leute schrecken die hohen Beschaffungskosten für Sole-Wasser-Wärmepumpen mit der Nutzung von Erdwärme ab. Doch die höheren Kosten werden durch die Einsparungen beim Stromverbrauch kompensiert und lassen sich im Rahmen einer Energie-Hypothek oft gut abfedern.»

Daniel Arm, Energieberater bei Primeo Energie, beantwortet Fragen zu Wärmepumpen.
Ist der Strom für die Wärmepumpe teurer als Gas oder Öl?
Die Kosten für die Heizenergie variieren von Jahr zu Jahr. Früher waren in den meisten Fällen fossile Energieträger günstiger. Allerdings nur, weil die Kosten für die Umweltschäden an die Allgemeinheit übertragen wurden. Mit höheren Emissionssteuern dürfte sich das aber ändern. Zudem kann man Kilowattstunden Strom nicht 1:1 in Kilowattstunden Öl oder Gas umrechnen wie bei den alten Elektrospeicher- und Widerstandsheizungen. Eine Wärmepumpe verwandelt dank der Übersetzungsfunktion des Kältemittels eine Kilowattstunde elektrische Leistung in 3,5 bis 5 kWh Wärmeleistung für Heizung und Brauchwasser.
Sind Wärmepumpen die einzige Lösung, um Öl- und Gasheizungen zu ersetzen?
Nein, es gibt noch andere Lösungen. Oft sind Wärmeverbünde oder Fernwärmesysteme genauso sinnvoll. Auch Pelletheizungen sind eine Lösung oder Holzschnitzelheizungen für grössere Überbauungen oder Liegenschaften. Zudem wird bei Sanierungen oft vergessen, dass sich mit dem solaren Direktgewinn sehr viel Sonnenenergie «ernten» lässt. Gerade bei Schulhäusern oder grösseren Liegenschaften, aber auch bei Einfamilienhäusern mit gut besonnten Süd-, Ost- und Westfassade. Hier können sonnenexponierte Räume so gestaltet werden, dass mineralische Boden- und Wandmaterialien die durch die Sonne eintretende Wärme speichern. Eine Lüftung verteilt die warme Luft im Haus. Dadurch lässt sich der Heizenergiebedarf massiv reduzieren. Solche Konzepte lassen sich auch bei Umbauten und Teilsanierungen relativ einfach realisieren.
Gibt es Situationen, in denen der Ersatz einer fossilen Heizung durch eine Wärmepumpe wenig Sinn macht?
Je nach Isolation des Hauses sowie persönlichen Präferenzen und Verhaltensweisen der Bewohner gibt es Häuser, die sehr wenig fossile Heizenergie benötigen. Wenn in solchen Häusern zusätzlich noch Schwedenöfen oder Cheminées in Betrieb sind, dient die fossile Heizung oft nur gerade zur Frostsicherung bei Abwesenheit der Bewohner und zur Vermeidung von Schimmelbildung. Bei so kleinen Verbräuchen ist der Aufpreis einer Wärmepumpe gegenüber einer effizienten Gasheizung kaum zu rechtfertigen. Zudem bieten Gasversorger auch erneuerbares Gas an. Sollte das Gasnetz dereinst stillgelegt werden, kann auch erneuerbares Gas aus Flaschen solche kleinen Verbräuche decken. Ein sinnvoller Heizungsersatz kann in solchen seltenen Fällen durchaus ein modernes Gasgerät in Kombination mit einem effizienten Wärmepumpenboiler fürs Warmwasser sein.

Umfassende, effiziente Energielösung: Eine Solaranlage, eine Wärmepumpe und eine Ladestation fürs Elektroauto gehen Hand in Hand.
Welche Folgekosten können noch entstehen?
Planung ist auch beim Heizungsersatz die halbe Miete. Wer eine Wärmepumpe einbaut, ersetzt damit idealerweise nicht nur die Ölheizung, sondern auch die Warmwasseraufbereitung. Sehr häufig ist das neue Gerät ein Elektroboiler mit sehr hohem Stromverbrauch. Entsprechend muss man allenfalls Wasserleitungen anders ziehen und einen Platz für einen Trinkwasser- oder einen Kombispeicher finden. Ein Kombi- oder Schichtspeicher ist ein Warmwasserspeicher, der im Inneren einen zweiten, T-förmigen Tank fürs heisse Brauchwasser enthält. In Kombination mit der Wärmepumpe funktioniert er wie eine Wärmebatterie. Die Wärmepumpe läuft zu Zeiten, in denen Strom billig ist oder gratis vom eigenen Dach kommt, und lädt den Speicher auf.
In älteren Häusern müssen bei der Installation von Wärmepumpen manchmal auch Sicherungskästen und Teile der Elektroinstallation ersetzt werden. Alte Schaltkästen enthalten oft Asbest, sodass bei der Sanierung besondere Vorsicht geboten ist.